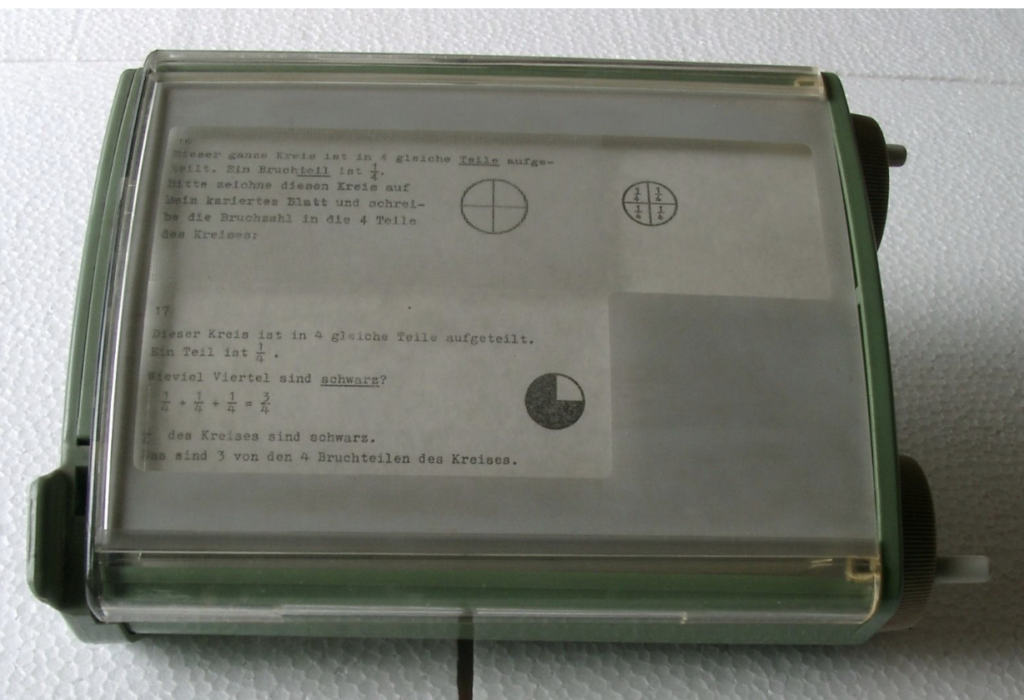
Texte sind letztlich narrative Regelwerke (siehe dazu „Strategies and Meanings in Games and Real Life“ in Narrative Mechanics >) inbegriffen ein Motivationsdesign zum Weiterzulesen im Kleinen wie im Grossen (Spannungsbögen). Texte sind also ein Gesetz/Programm für den Leser*. Dieser Leser* setzt sie im Lesen (Semiose) um oder anders gesagt: Texte laufen auf dem „Menschen als Medium“. Diese Gesetze werden im Commitment „sie zu lesen“ absolut und die Lesenden prozessieren den Magic Circle dieses Textes – in seiner Fiktion. Wobei natürlich alle Texte auch Teile der digitalisierten Gutenberg Galaxis sind – dem Netzwerk hinter den Texten. Dieses wird ja gerade fleissig in Neuronale Netze (nicht stark logische regelbasierte Netzwerke) überführt. Und zur Gutenberg Galaxis gehören dann auch konkretere Regeltexte wie Gesetzestexte. Texte also die auch konkrete Auswirkungen haben.
Vor dem Gesetz des Textes
Und hier sind wir mitten im Spiel von Kafkas Regelwerken alias Texten und ihrer Metaebene oder anders gesagt: „Vor dem Gesetz“ von Kafkas Texten. Wir lesen sie, prozessieren sie.
Kafkas Texte spielen in der Form ihrer Rezeption wie inhaltlich mit diesem „Vor dem Gesetz“ des Textes. Der Text bleibt dabei unhintergehbar. Er ist schwarz auf weiss = gedruckt. Er existiert und der Rezipient* ist ihm ausgeliefert. Er vollführt ihn sogar und setzt sich gleichzeitig damit auseinander. Ein eigentlich krasser Akt, gerade wenn Texte widerständig oder gegen die eigenen (ethischen) Ideen sind. Dieser Umgang mit ‚Fiktion‘ ist selbstverständlich ein Teil der gesellschaftlichen (Aus-)Bildung – ein Emanzipationsschritt gegen Texte und ihre Regeln. Man könnte auch sagen: Texte (wie Filme) „vergewaltigen“ die Lesenden* im Lesen (freiwillig) und diese müssen dies aushalten (siehe die Diskussion um Don Quijote als ersten modernen Roman). Das vielleicht bürgerlichste Konzept: Diesen Spagat auszuhalten. Dieses Aushalten spielt bei Kafkas Konstrukten eine massive Rolle, strapaziert es die Lesenden bis zum Exzess: „Warum sind die Geschichten so, wie sie sind?“,“Warum lese ich weiter?“, „Warum breche ich nicht ab?“ oder anders gesagt: „Warum ist das Gesetz des Textes, so wie es ist?“.
In Fiktionen
In Kafkas Software für Menschen sind Personen, Figuren, Tiere einer Welt ausgesetzt, die sie letztlich nicht verstehen. Sie sind vor den Gesetz von Gesetzen, aber wissen nicht warum. Man könnte es auch offener formulieren: Sie sind Teil eines Spiels, dessen Regeln sie nur minimal kennen und meist marginal beeinflussen können. Sie sind Teil eines (kybernetischen) Systems bei dem ihr mögliches Handeln marginal oder sehr normiert ist. Oder mit Huizingas Homo Ludens Modell gesprochen: Wir leben sozial in einer Welt aus Regeln.
Der Spieler vor dem Spiel
Provokanter könnte man sagen: die Protagonisten bei Kafka sind Spieler* eines Spiels, das mit ihnen gespielt wird. Es gibt zwar Agency also Gameplay, nur dieses ist nicht besonders offen. Es ist auch durch die eigenen Vorstellungen, die eignen Möglichkeiten der Protagonisten eingeschränkt. Diese Möglichkeiten sind eben auch die kognitiven Möglichkeiten, die Anerkennung des (Gesellschafts-)Systems. Es kommt nicht zu einem gewaltsamen Versuch des Bruchs. Der Diskurs (hier Text) ist also mächtig genug, um jede Revolte zu unterbinden. Und zwar für den Protagonisten (wie den Leser*).
Nichts weniger ist erlebbar beim Lesen von „Vor dem Gesetz„. Anders gesagt: Der Player* kann nicht vorwärts kommen ins Gebäude. Es gibt ja einen „Gate/Doorkeeper“. Der Protagonist glaubt letztlich dem Türsteher (und vielleicht dessen Rhetorik). Er zweifelt das Gesetz nicht mal an (hier als Diskussion). Widerstand zwecklos.
Die Revolte gegen das Gesetz
Diese Revolte passiert nicht, weil der Spielende* sich an die Regeln hält und er übertritt nicht den Text, übertritt nicht die gesellschaftlichen Regeln. Darin liegt der radikale Moment und so hilflose Moment. Die Angst vor dem „Regelwerk“ bzw. den Möglichkeiten. Die Möglichkeit den Text und das Gesetz zu übertreten, es neu zu schreiben. Soweit gehen die Protagonisten von Kafkas Texten (und seine Leser* damit) jedoch nie. Es ist schwierig, das Gesetz oder den Prozess zu übertreten. Am Ende hält in Kafkas Fiktionswelten und deren Protagonisten die (soziale) Gesetzlichkeit die Oberhand – sogar bis die Protagonisten sterben. Widerstand mit einer Revolution scheint nicht möglich.
Das fehlende Dahinter
Dabei wissen die Protagonisten auch nicht, wer und zu was sie verurteilt wurden – etwa in der „Strafkolonie„. Sie erahnen es nur, es wird ihnen eingraviert, das Urteil auf den Rücken. Die Strafe ist das Einritzen der Regeln bis zum Tod. Für sie ist es unleserlich und sie bemerken oft erst im Sterben, was es war (welche Regeln, Ereignisse) sie verurteilt und getötet hat. Erleben von Gesellschaft kann natürlich genau so erlebt werden. Sterben durch die Regeln.
Die verborgenen Regeln
Die Regeln sind also selbst im Tod konkret verborgen. Hier wie in vielen der Fiktionen (oder Realitäten) wird – wegen fehlender offener Gamemechanik (Gesamtes Regelwerk) – der Text von Kafka zur Metapher oder zum Spieler* im Spiel zu einem Game, das er nicht kennt.
Das Abstrakte von Kafkas Texten wird dabei noch abstraker (metaphorischer) und die Texte lassen sich dadurch auch sehr gut (de- und) reterritorialisieren in die eigene Welt, die eigenen Welten. So ist es denn auch kein Zufall, dass in vielen Spielen die Spielenden als (metaphorische) „Käfer“ in Games stranden und sich zuerst fragen müssen: Was wird hier eigentlich gespielt? Welche Regeln gelten hier? Die Spielenden* werden ja auch geradezu in eskapistische Welten geworfen. Sehr oft auf Inseln oder abgegrenzte Bereiche – Spielende* könnten ja sonst davonrennen. Gregor Samsa hingegen wird „wiedergeboren“ in seine eigene Welt, nun aber sind die sozialen Regeln defiktionalisiert (agency) und er damit als Käfer hilflos „unterwegs“ (Reentry der Regeln). Es gibt hier eine Art Verschärfung der Regeln ohne die Möglichkeit einer spielerischen Fiktion.
Der Algorithmus – Kybernetik in Aktion
Radikal wird dieses Explizieren und Erleben von Regeln bei den „Romanen“ von Kafka wie „Das Urteil„, „Der Prozess“ oder „Das Schloss„. Hier stehen zum einen die Titel für den Inhalt in doppeltem Sinn, aber noch viel mehr für die Logik: Der Prozess und das Schloss. Es ist letztlich gleichgültig welches Kapital gelesen wird. Es ist eigentlich immer dasselbe, derselbe Mechanismus, dieselbe Kybernetik. Es ist die Verneigung davor „Ja zu sagen“, „Gefangen zu sein“ – den Algorithmus anzuerkennen. Es wird in Bahnen gelaufen, in Labyrinthen.
Insofern ist und bleibt Kafka als Autor, einer der Kybernetiker der Kybernetiker, dessen Texte Gesellschaft als Maschine erlebbar macht. Es ist deswegen auch kein Zufall, war er zu seinen Lebzeiten de facto unbekannt und ist erst durch den französischen Existentialismus wieder im Deutschen reimportiert worden. Es braucht Zeit, bis Gesellschaften in ihr Regelwerk schauen möchten.
Seine Schriften unterscheiden sich auch radikal vom Aufklärung-zu-Ende-Denkenden De Sade etwa in Justine und Juliette. Auf Justines Seite geht es, um die kafkaeske Welt der Justine (Soziales Gameplay). Es ist ein ohnmächtiger Kampf gegen das System (Gameplay). Auf der anderen Seite hingegen schlägt sich Juliette auf die Seite der „Macher*“ und des Systems mit voller Macht und den Möglichkeiten das Spiel zu bestimmen (Spielmechanik). Juliettes Welt fehlt Kafkas Texten meist völlig.
Die Kybernetik (Letztlich die Wissenschaft von Regelkreisläufen) beginnt in den 30er+ Jahren mehr und mehr von einer beschreibenden Methode der Natur zu einer angewandten Methode auf die Gesellschaft zu werden. Systemtheorie und deren Konzepte werden immer Wirkungsmächtiger auch im Umfeld von mindestens zwei konkurrierenden Systemen. Auch wenn Systemtheorien erst viel später als Text und Modell lesbar gemacht wurden.
Software – der neue Text
Die Defiktionalisierung von Regeln als Software (Es gibt ja nicht umsonst die These, dass Luhmann einen Teil seiner Systemtheorie entwickelt hat anhand von Software und Unternehmen) wird immer zentraler gesellschaftlich und so sitzen wir heute vor völlig nicht offen kommunizierten Gesetzen/Code in Software und Games. Wir sitzen also noch radikaler vor Texten, die ausgeführt werden und einen Einfluss auf unser Leben haben, ohne dass wir diese auch ansatzweise zu verstehen. Damit geht letztlich die Defiktionalisierung von Regeln ins Reale weiter.
Oder als Fabel von Kafka zusammengefasst:
Kleine Fabel
»Ach«, sagte die Maus, »Die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, daß ich Angst hatte, ich lief weiter und war glücklich, daß ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah, aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, daß ich schon im letzten Zimmer bin, und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe.« – »Du mußt nur die Laufrichtung ändern«, sagte die Katze und fraß sie
